Schwulenstereotype in Gay-Comics. Eine qualitative Inhaltsanalyse von Comicsequenzen
Die mediale Darstellung von Geschlecht und Sexualität homosexueller Männer erfolgt mehrheitlich entlang weniger Stereotypen (vgl. Miller/Lewallen 2015: 360; Coyne et al. 2014: 416). Einerseits bleiben Geschlechterstereotype als Form der Stigmatisierung bestehen, weil sie durch ihren vereinfachenden Charakter eine Strukturierung der komplexen sozialen Welt in In- und Outgroups ermöglichen und dadurch Identität stiften (vgl. Meisenbach 2010: 268). Andererseits sind sie Abbild der fortwährenden Dominanz jener heteronormativen Gesellschaftsstrukturen, durch welche sie erzeugt werden (vgl. Murnen et al. 2016: 78). Auch durch die zunehmende Sichtbarkeit von Schwulen in der heteronormativen Populärkultur erfolgt kein Bruch mit Schwulenstereotypen, sondern lediglich deren Vervielfältigung (vgl. Shugart 2003: 88). Während sich bisherige Studien hauptsächlich auf die Darstellung von Schwulen in der Populärkultur (Outgroup-Perspektive) konzentriert haben (vgl. Murnen et al. 2016; Avila-Saavedra 2009; Shugart 2003), widmet sich der Beitrag dem alternativen Subgenre der Gay-Comics. Dabei handelt es sich um ein Medium von mehrheitlich homosexuellen Autor_innen für ein primär homosexuelles Zielpublikum und kann der sog. Ingroup-Perspektive zugeordnet werden (vgl. Padva 2011: 401). Mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse von Gay-Comicsequenzen wird konkret nach Darstellungsweisen von Schwulen aus der Ingroup-Perspektive gefragt: Wie und mit welchen Stereotypen werden Schwule (von Schwulen) dargestellt?
Tobias Rohrbach
Studienrichtung: MA in Kommunikationswissenschaft und Medienforschung im Hauptfach, MA in Soziologie (Spezialisierung: Geschlecht, Staat, Politik) im Nebenfach
Forschungsinteressen: Fachidentität, Theorie- & Fachgeschichte, Medienpolitik, Gender Studies, Methoden
Mail: tobias.rohrbach@unifr.ch

 Studienrichtungen: Politikwissenschaften und Critical Studies
Studienrichtungen: Politikwissenschaften und Critical Studies

 Christian Berger ist juristischer Mitarbeiter beim Klagsverband und studiert Rechtswissenschaften, Gender Studies und Sozioökonomie in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Legal Gender Studies, Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsrecht, interdisziplinäre Rechtsforschung und Politische Ökonomie.
Christian Berger ist juristischer Mitarbeiter beim Klagsverband und studiert Rechtswissenschaften, Gender Studies und Sozioökonomie in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Legal Gender Studies, Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsrecht, interdisziplinäre Rechtsforschung und Politische Ökonomie.

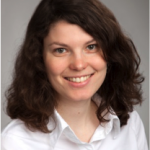 Studienrichtung: MA Historisch-kulturwissenschaftliche Europaforschung, BA Kultur- und Sozialanthropologie
Studienrichtung: MA Historisch-kulturwissenschaftliche Europaforschung, BA Kultur- und Sozialanthropologie