Manns genug?
Personalisierung und gender conflict framing in der Medienberichterstattung zum Nationalratswahlkampf 2017
„Sei ein Mann: Wähl eine Frau.“ Dieser Slogan der Grünen, welcher die ungleichen Geschlechterverhältnisse thematisieren soll, ließ gleich zu Beginn des Wahlkampfes die Wogen hoch gehen. Wie schon bei den Nationalratswahlen 2013 stellen auch dieses Jahr Spitzenkandidatinnen die Ausnahme dar. Lediglich drei der 13 kandidierenden Parteien haben eine Frau auf dem ersten Listenplatz stehen. Diese ungleiche Verteilung und die offensive Thematisierung auf Wahlplakaten rücken das Geschlecht der Kandidat_innen im Wahlkampf in den Fokus und fordern somit eine genderreflektierende Untersuchung ein. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass der dichotome Charakter von Geschlecht als Strukturkategorie über das biologisch konzipierte Geschlecht – und das Verhältnis von bipolar gedachten Körperlichkeiten von Frauen und Männern in politischen Institutionen – hinaus geht. Geschlecht ist performativ und wird unter anderem über eine vergeschlechtlichte Sprache verhandelt. In Anlehnung an Meredith Conroys Konzept des gender conflict framing werden deshalb potentielle mediale Zuschreibungen von vergeschlechtlichten (Charakter)Merkmalen an die Spitzenkandidat_innen in den Blick genommen. Die Datengrundlage für diese Untersuchung bildet eine quantitative Inhaltsanalyse der Medienberichterstattung von elf regionalen und überregionalen Print- und TV Medien in Österreich. Die Stärke dieses Ansatzes für eine genderspezifische Untersuchung der Wahlkampfberichterstattung zur Nationalratswahl in Österreich liegt in der Analysemöglichkeit der Implikationen von Gender nicht nur zwischen den stark unterrepräsentierten Spitzenkandidatinnen und ihren männlichen Pendants, sondern auch zwischen den männlichen Kandidaten.
Manuel Mayrl
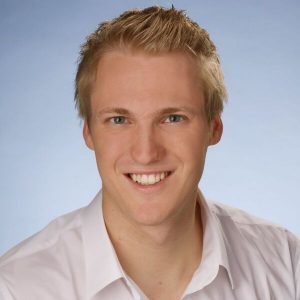
manuel.mayrl@student.uibk.ac.at
Masterstudium Gender, Kultur und Sozialer Wandel an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Forschungsinteressen: Wahlforschung, kritische Männlichkeitsforschung, Rechtsextremismus- und Antisemitismusforschung





