Weiße Spenden für Schwarze Subjekte. Repräsentation und Konstruktion Schwarzer Frauen in Spendenwerbung
Die Arbeit „weiße Spenden für Schwarze Subjekte – Repräsentation und Konstruktion Schwarzer Frauen in Spendenwerbung“ thematisiert die Bildrepräsentation Schwarzer Frauen, die anhand der letzten Kampagne der Nichtregierungsorganisation „Licht für die Welt“ untersucht wurde.
Es wurden, nach einer Beschreibung der Motivation und des Forschungsstandes Konstrukte,die den drei ausgewählte Werbesujets der Kampagne inne liegen, herausgearbeitet und in Bezug auf stereotypisierende, sexistische oder rassistische Darstellungsweisen untersucht. Dazu wurde Bezug genommen, auf Forschungen zum Thema Frau in der Werbung, Schwarzen / PoC in der Werbung sowie spezifischer Schwarze in der Spendenwerbung. Mit diesem Input und auch aktuelleren Forschungen aus Deutschland, wurde die Kampagne „Lasst den Schatten des graue Stars verschwinden“ zum einen, einer semiotischen Bildanalyse unterzogen. Zum anderen wurde in einer Gruppendiskussion mit Schwarzen Frauen diese Kampagne beurteilt. Ziel war es, die Stimmen der Frauen einzuholen die direkt von diesen Bildrepräsentationen betroffen sind.
In Anlehnung an das Encoding Decoding Modell Halls wurde deutlich, dass die Schwarzen Frauen als Betroffene Frauen sehr kritisch rezipierten. Die Konstruktionen die anhand der Bildanalyse herausgearbeitet wurden, ob in Bezug auf Gender, Rassismus und/oder Stereotype wurden alle von ihnen herausgearbeitet und dieskutiert. Bei allen positiven Absichten der WerbemacherInnen, entgegen gängigen Klischees zu werben, reproduzieren auch sie problematische Darstellungen von Schwarzen Menschen und vor allem Frauen. Das diese Kampagne problematische Bilder Schwarzer Menschen und Schwarzer Frauen reproduziert, wurde sowohl anhand der Bildanalyse, als auch durch die Einschätzungen und Äußerungen der Diskussionsteilnehmerinnen deutlich.
Naomi Afia Güneş-Schneider
 Naomi Afia Güneş-Schneider studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Während ihres Studiums, aber auch darüber hinaus setzt sie sich mit Stereotypen, Konstruktionen „der Anderen“ im Alltag auseinander. Da diese Konstruktionen vor allem durch verschiedenste Medien Verbreitung finden, waren und sind diese Themen von Beginn an Schwerpunkt in ihrem Forschungsinteresse.
Naomi Afia Güneş-Schneider studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Während ihres Studiums, aber auch darüber hinaus setzt sie sich mit Stereotypen, Konstruktionen „der Anderen“ im Alltag auseinander. Da diese Konstruktionen vor allem durch verschiedenste Medien Verbreitung finden, waren und sind diese Themen von Beginn an Schwerpunkt in ihrem Forschungsinteresse.
Sie erhofft sich, Bewusstsein für konstruierte Bilder schaffen zu können und vor allem, diese zu dekonstruieren.
E-Mail: guenes.schneider@gmx.net
 Christian Berger ist juristischer Mitarbeiter beim Klagsverband und studiert Rechtswissenschaften, Gender Studies und Sozioökonomie in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Legal Gender Studies, Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsrecht, interdisziplinäre Rechtsforschung und Politische Ökonomie.
Christian Berger ist juristischer Mitarbeiter beim Klagsverband und studiert Rechtswissenschaften, Gender Studies und Sozioökonomie in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Legal Gender Studies, Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsrecht, interdisziplinäre Rechtsforschung und Politische Ökonomie.

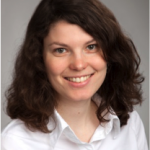 Studienrichtung: MA Historisch-kulturwissenschaftliche Europaforschung, BA Kultur- und Sozialanthropologie
Studienrichtung: MA Historisch-kulturwissenschaftliche Europaforschung, BA Kultur- und Sozialanthropologie
 Studienrichtungen: MA Theater-, Film und Mediengeschichte; BA Orientalistik, Schwerpunkt Arabistik
Studienrichtungen: MA Theater-, Film und Mediengeschichte; BA Orientalistik, Schwerpunkt Arabistik Studium: Journalismus und Medienmanagement (FH Wien), Vergleichende Literaturwissenschaft (Universität Wien)
Studium: Journalismus und Medienmanagement (FH Wien), Vergleichende Literaturwissenschaft (Universität Wien) Studienrichtung: M.A. European History, ein internationaler Studiengang an der Humboldt-Universität zu Berlin, derzeit jedoch im Studium am King’s College London und zuvor ein Semester an der Universität Wien.
Studienrichtung: M.A. European History, ein internationaler Studiengang an der Humboldt-Universität zu Berlin, derzeit jedoch im Studium am King’s College London und zuvor ein Semester an der Universität Wien. Name: Michael Holzmayer
Name: Michael Holzmayer