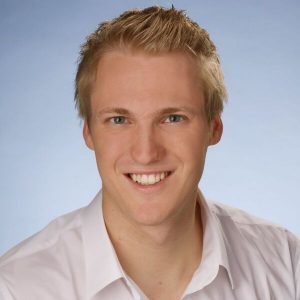Das Begehren des Öffentlichen
Analyse des Facecook-Subjekts im Vergleich mit antiken Selbsttechnologien
Um besser zu verstehen, mit was für einer Art von Öffentlichkeit(en) wir es gegenwärtig zu tun haben, bedarf es einer Analyse jenes Subjekts, welches im Zentrum derselben steht. – Nur so wird es möglich sein, zu gangbaren Alternativen und Ausstiegsszenarien zu gelangen. Welches Subjekt also wird hier bespielt, was für ein Begriff von Menschsein wird – im Sinne Althussers – „angerufen“?
Warum gibt dieses Subjekt so gerne und so viel von sich preis? Am Beispiel der Praktiken von Facebook soll Deleuzes Beschreibung der heute herrschenden Machtverhältnisse als „Kontrollgesellschaften“ plausibilisiert werden, um den Konnex zwischen den Begehrensstrukturen des Subjekts des Web 2.0 und den soziopolitischen Gegebenheiten nachzuvollziehen.
Mit Wiedemann und Foucault wird der homo oeconomicus als ontologische Grundlage des Facebook-Subjekts identifiziert und der Figur des stultus von Seneca gegenübergestellt. So werden Potenziale, aber auch Grenzen der Engführung der Facebook-Praktiken mit antiken Selbsttechnologien offenbar.
Mit dem homo oeconomicus begegnen wir einer Figur, die das Ende einer offen interventionistischen Politik ausruft, wohingegen die stoische Erziehung stark auf die Interventionen des Lehrers setzt. Die inoffizielle, affektive Mobilisierung der Subjekte begünstigt – in diametralem Gegensatz zur stoischen Lehre – die Verringerung der Reflexionsmöglichkeiten über die eigenen Emotionen und führt damit zu einer erhöhten Beeinflussbarkeit, bzw. Regierbarkeit der Subjekte.
Die differentia specifica des Facebook-Subjekts gegenüber dem homo oeconomicus liegt in der Unterbrechung der Unmittelbarkeit sozialer Kontakte – und in der Entstehung von „Beobachtungskreisen“: Das Surfen auf Facebook ist ein Beobachten, wie andere beobachten, wie man sich selbst beobachtet. Die Zurückgeworfenheit des Subjekts auf sich selbst – auch und besonders im Umgang mit der/dem Anderen – führt in eine Nivellierung der Dimension der Alterität.
Miriam Metze

Studienrichtung: Philosophie
Forschungsinteressen: Heideggers Sprachphilosophie, Nietzsche, Foucault, Agamben, jüdische Mystik
Derzeit MA-Arbeit zum Thema „Zeugnis und Zeugenschaft bei Martin Heidegger“ bei Prof. Kurt Appel
Veröffentlichungen:
„Die apophantische Tautophasis. Eine Querlesung von Heideggers Zeit und Sein und einigen Besonderheiten der hebräischen Grammatik“, in Existentia. Meletai Sophias. XXVI (1-2), 2016, 2-24.
in Druck: „Auf der Suche nach Rettendem. Ethisch-politische Implikationen der Philosophie Giorgio Agambens im Dialog mit Martin Heideggers „Humanismus“-Brief und dem Spiegel-Interview“ in: Existentia. Meletai Sophias. XXVII, 2017.
Miriam.metze@univie.ac.at